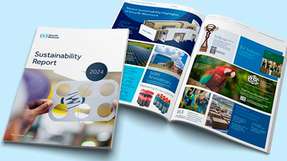ZERO: Herr Konerding, die EU-Kommission hat mit dem Omnibus-Paket die ESG-Regulatorik gelockert. Ist das eine Entlastung oder ein Rückschritt für die Logistikbranche?
Jan-Frederik Konerding: Kurzfristig bringt das Omnibus-Paket tatsächlich Erleichterung – insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, deren unmittelbare Berichtspflichten reduziert werden. Langfristig jedoch bleibt der Handlungsdruck hoch: Kunden, Banken und Investoren fordern weiterhin belastbare ESG-Daten. Wer jetzt abbremst, riskiert den Anschluss zu verlieren. Die Lockerung sollte deshalb nicht als Rückschritt verstanden werden, sondern als Gelegenheit, ESG strategisch vorzubereiten – bevor der regulatorische Takt wieder anzieht.
Wo stehen wir denn aktuell in der Regulatorik?
Wir erleben gerade eine Phase intensiver Anpassungen. Auf EU-Ebene verschiebt das sogenannte „Stop-the-Clock“-Verfahren die Berichtspflicht für die zweite Welle um zwei Jahre. Gleichzeitig werden Schwellenwerte und Berichtsinhalte neu justiert. Besonders relevant: Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) werden gestrafft – rund 60 Prozent weniger verpflichtende Datenpunkte bedeuten weniger Umfang, aber nicht weniger Anspruch an Datenqualität. In Deutschland liegt der Referentenentwurf zur nationalen Umsetzung der CSRD nun vor. Geht er wie geplant durch, müssen Unternehmen der ersten Welle ab dem Geschäftsjahr 2025, die zweite Welle ab 2027 berichten. Wer denkt, er könne deshalb warten, irrt sich – die Erfahrungen aus Welle 1 zeigen: ein sauberer Prozess braucht in der Regel 12–18 Monate Vorlauf. Trotz Reduktion bleibt die Erfassung von z.B. Scope-3-Emissionen – also Emissionen entlang der Lieferkette – eine der größten Herausforderungen. Gleiches gilt für Themen wie Sozialstandards bei Subunternehmern oder die Integration von ESG-Daten in bestehende ERP-Systeme. Diese Komplexität bleibt und erfordert frühzeitige Abstimmung zwischen Einkauf, Logistik, IT und Compliance.
Neben Regulatorik, welche Treiber für Nachhaltigkeit gibt es darüber hinaus?
ESG ist längst mehr als ein gesetzlicher Pflichttermin – es ist ein Marktfaktor. Kunden vergeben Aufträge zunehmend nur an Unternehmen mit nachweisbarer Nachhaltigkeits-Performance. Banken und Investoren koppeln Konditionen an ESG-Kennzahlen. Und Lieferkettenpartner setzen Nachhaltigkeitsstandards voraus, um überhaupt gelistet zu werden. In der Praxis sehen wir: Fehlende Zertifizierungen oder mangelhafte ESG-Daten können dazu führen, dass Unternehmen aus Ausschreibungen herausfallen oder schlechtere Kreditkonditionen erhalten. Umgekehrt kann eine überzeugende ESG-Strategie Zugang zu Märkten schaffen, Finanzierungsvorteile bringen und das Vertrauen der Stakeholder stärken.
Was bedeutet das für die Unternehmen?
Wer ESG nur als lästige Berichtspflicht versteht, vergibt Chancen. Richtig eingesetzt, kann es ein Hebel für Effizienz, Differenzierung und Resilienz sein. Bereits erste gezielte Maßnahmen – etwa zur Dekarbonisierung von Fuhrpark und Lagerlogistik – können messbare Effekte bringen. Das muss nicht immer sofort ein voll ausgebautes Nachhaltigkeitsmanagement sein. Wichtig ist, den Einstieg zu finden, Fortschritte messbar zu machen und diese konsequent auszubauen. Die Regulatorik kann dann als glaubwürdige Kommunikationsbasis dienen. Je nach Ressourcenlage kann auch die Auslagerung einzelner ESG-Prozesse an spezialisierte Dienstleister sinnvoll sein. Quick-Wins und erste Schritte im Logistiksektor umfassen beispielsweise Energieaudits für Lagerhallen, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Dekarbonisierung von Logistikimmobilien, Einführung von HVO100 oder Book & Claim, die Optimierung von Verpackungskonzepten, digitale Tourenplanung oder den Testbetrieb von E-Fahrzeugen im Nahverkehr. Solche Maßnahmen sind innerhalb von 6–12 Monaten umsetzbar und können bereits vor der ersten Berichtsperiode belastbare Erfolge liefern.
Wie können mittelständische Logistikunternehmen trotz begrenzter Ressourcen den ESG-Anforderungen gerecht werden?
Es braucht einen klaren Fahrplan: Erstens: Wertschöpfungskette abgrenzen – insbesondere die vorgelagerten Prozesse sauber definieren. Zweitens: Wesentlichkeits- und Resilienzanalyse durchführen – um relevante Themenfelder zu priorisieren. Drittens: Umsetzungsfahrplan definieren – Meilensteine, Verantwortlichkeiten und Budgetrahmen festlegen, um Projekte planbar zu machen. Viertens: Governance aufbauen – klare Verantwortlichkeiten und Abläufe definieren, bevor der Druck steigt. Fünftens: Digitale Tools nutzen – modulare Systeme können Aufwand und Kosten deutlich senken. Wer so vorgeht, baut Schritt für Schritt ein skalierbares ESG-Management auf, das sich an künftige regulatorische Anforderungen anpassen lässt.
Große Logistiker investieren in E-Trucks, Wasserstoff und KI. Wie können kleinere Unternehmen mithalten, ohne überfordert zu sein?
Es geht nicht um „alles oder nichts“. Kleine, gezielte Schritte sind oft wirksamer als große, riskante Investitionen. Wer zum Beispiel Routen optimiert, Leerfahrten vermeidet oder Kooperationen bei Einkauf und Infrastruktur eingeht, kann sofort Kosten senken und Emissionen reduzieren. Technologie muss nicht immer selbst angeschafft werden – Partnerschaften mit Plattformanbietern oder Poollösungen ermöglichen den Zugang zu Innovation, ohne das eigene Budget zu sprengen. In der Praxis sehen wir beispielsweise, dass mittelständische Spediteure Ladeinfrastruktur über Standortgemeinschaften teilen oder Wasserstofffahrzeuge über Leasingmodelle in Kooperation mit OEMs nutzen.
Was ist Ihr konkreter Handlungsaufruf an die mittelständische Logistikbranche?
Nutzen Sie das aktuelle regulatorische Zeitfenster aktiv. Starten Sie jetzt mit einer strukturierten Wesentlichkeits- und Resilienzanalyse. Das schafft Klarheit, wo Handlungsbedarf besteht – und ermöglicht es, Prioritäten zu setzen, bevor der nächste regulatorische Schub kommt. Wer früh beginnt, stärkt nicht nur die eigene Position in der Lieferkette, sondern sichert sich auch einen Platz in einem Markt, der Nachhaltigkeit zunehmend als Eintrittskarte begreift. Andernfalls riskieren Unternehmen, in zwei bis drei Jahren unter Zeitdruck teure Schnelllösungen umsetzen zu müssen – oft mit höherem Kosten- und Ressourcenaufwand, als wenn man heute geplant startet.
Über Jan-Frederik Konerding
Jan-Frederik Konerding ist seit 2013 bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er ist Experte für Regulatorik, Governance, externes Reporting und Nachhaltigkeit und begleitet seit vielen Jahren Transformationsprojekte. Mit einem großen Fokus auf Familienunternehmen, den Mittelstand und börsennotierte Konzerne leitet Jan-Frederik die prüfungsnahe Beratung der KPMG in Norddeutschland mit Teams an sechs Standorten und unterstützt Unternehmen bei regulatorischen Anforderungen und nachhaltigen Strategien. Seit dem 1. Januar 2025 ist Jan-Frederik der KPMG ESG Branchen Lead für Transport, Logistik und Infrastruktur.