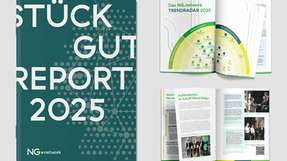Im Jahr 2024 hat der Verkehrssektor in Deutschland erneut sein gesetzlich festgelegtes Ziel verfehlt: Das Klima wurde mit rund 143 Millionen Tonnen Treibhausgasen belastet – und damit trägt der Sektor gut über ein Fünftel zu diesen Emissionen bei. Wird die Logistikbranche zum Treiber eines grundlegenden Wandels – oder bleibt sie der Bremsklotz?
Wer weiterhin auf fossile Energien setzt, verteidigt ein System, das längst an seine Grenzen gestoßen ist. Einige Unternehmen hinterfragen bestehende Strukturen und Technologien – gerade weil sie auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig Verantwortung gegen ein zu schnelles Fortschreiten des Klimawandels übernehmen möchten. Anderen fällt die Veränderung noch schwer, da Gewohnheiten tief verankert sind.
Doch technologische Fortschritte haben unseren Alltag in der Vergangenheit bereits mehrfach grundlegend verbessert. Ein Beispiel ist die Einführung von Katalysatoren in Autos – einst kontrovers diskutiert, heute eine Selbstverständlichkeit. Der aktuelle Umbruch im Verkehrssektor ist eine vergleichbare Entwicklung. Der Unterschied zwischen konventionellen Verbrennungsmotoren und elektrischen Fahrzeugen ist längst spürbar – sei es in Bezug auf Emissionen, Lärm oder Effizienz. Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob alternative Antriebe eingeführt werden sollten, sondern wie dies am effektivsten geschieht.
Nachhaltigkeit als Notwendigkeit
Die Klimakrise ist Realität. Unternehmen, die langfristig bestehen wollen, analysieren ihre Emissionen, identifizieren Hauptquellen und setzen gezielt Maßnahmen zur Dekarbonisierung um. Nachhaltigkeit bedeutet dabei mehr als Klimaschutz: Sie erfordert eine Balance zwischen ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung. Das Leitbild der Brundtland-Kommission fordert, dass eine dauerhafte Entwicklung die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Oder anders gesagt: Bei allem, was heute beschlossen wird, muss es auch um die Enkelfähigkeit gehen.
Vier-Punkte-Strategie Nachhaltigkeit
Grundsätzlich lässt sich nachhaltiges Wirtschaften mit dem Dreiklang „Vermeiden, Reduzieren und Kooperieren“ beschreiben. Auf dem Weg dahin gilt es, sich an vier wichtigen Wegpunkten zu orientieren:
■ Daten messen und analysieren: Transparenz ist der erste Schritt zur Dekarbonisierung. Gängige Standards und Normen wie die neue ISO 14083 helfen dabei, Berechnungen nachvollziehbar und vergleichbar zu gestalten.
■ Emissionen vermeiden: Anstatt hohe Beträge für Emissionszertifikate oder steigende CO2-Preise auszugeben, lohnt es sich, frühzeitig in CO2e-reduzierende Technologien zu investieren. Hauptverursacher sollten gezielt identifiziert und nachhaltige Alternativen entwickelt werden.
■ Emissionen reduzieren: Es gilt, die fortschrittlichste verfügbare Technologie, die den operativen Anforderungen entspricht und den Energieverbrauch senkt, einzusetzen. Das ist der Schlüssel zur Emissionsreduktion.
■ Kooperationen ausbauen: Die Begrenzung der Erderwärmung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Unternehmen profitieren von einem Netzwerk aus Partnern, die an der Dekarbonisierung arbeiten. Dazu gehören neben dem eigenen Team Subunternehmen, Dienstleister, Politik, Kommunen und ganz wichtig: die Kunden.
Vom Test zur Skalierung
Wo die Mittel der Vermeidung ausgeschöpft sind, sind neue Technologien entscheidend. Testphasen liefern wertvolle Daten und reduzieren bereits in Erprobungsphasen die Emissionen. Sobald sich eine Technologie als wirtschaftlich und operativ tragfähig erweist, kann sie skaliert werden. Im Transportbereich hat sich die Elektrifizierung von Lkw als praktikable Lösung erwiesen. Trotz anfänglicher Skepsis – etwa hinsichtlich Praxistauglichkeit, Reichweite und Ladezeiten – zeigen realisierte Projekte, dass batterieelektrische Lkw bereits heute effizient einsetzbar sind.
Schwere E-Lkw erreichen mittlerweile tägliche Fahrleistungen von bis zu 500 Kilometern ohne Zwischenladung. In Kombination mit emissionsarmen Transportmitteln wie Binnenschiff und Bahn entstehen nahezu klimaneutrale Logistiklösungen. Fördermaßnahmen wie Subventionen unterstützen und ermöglichen Investitionen in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Bei Betrachtung aller Kostenfaktoren ist der batterieelektrische Antrieb bereits heute wirtschaftlich konkurrenzfähig.
Chancen und Grenzen
Neben batterieelektrischen Lkw gibt es weitere Technologien, die zur Dekarbonisierung beitragen können. Doch gilt es, diese auch mit einem kritischen Auge zu betrachten:
■ Wasserstoff: Derzeit ist der alternative Kraftstoff für den Lkw-Sektor noch nicht wirtschaftlich einsetzbar. Zudem ist der Einsatz von mit Wasserstoff betriebenen Lkw ineffizienter als Batterielösungen – und die Infrastruktur ist begrenzt.
■ E-Fuels: Synthetische Kraftstoffe lassen sich gegenwärtig nur zu hohen Kosten und unter erheblichen Energieverlusten produzieren. Diese Option ist für den Straßengüterverkehr eher unattraktiv.
■ HVO (Hydrierte Pflanzenöle): Dieser biogene Kraftstoff kann als Brückenlösung dienen, ist aber nur begrenzt verfügbar. Vor diesem Hintergrund kann HVO100 keine langfristige Lösung sein, auch auf der Kostenseite nicht.
Die Transformation eines Transportunternehmens endet nicht bei der Fahrzeugwahl. Ein intelligenter, nachhaltiger Ansatz umfasst auch die Energieversorgung. Die Installation von Photovoltaik- und Windkraftanlagen, gekoppelt mit Energiespeichern und intelligenten Managementsystemen, macht eine weitgehende Eigenversorgung mit grüner Energie und damit eine Dekarbonisierung der Logistik möglich.
Das lohnt sich, denn klimafreundliche Logistiklösungen werden zunehmend honoriert – sowohl durch regulatorische Anreize als auch durch eine wachsende Kundennachfrage. Aber Nachhaltigkeit sollte kein „Nice-to-have“ bleiben, sie erfordert eine feste Verankerung in der Unternehmensstrategie – inklusive Ressourcen, klarem Management-Commitment und konkreter Maßnahmen.
Dieser Weg erfordert Mut, Innovation und enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Unternehmen, die diese Herausforderungen aktiv angehen, leisten nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern gehen langfristig gestärkt aus diesem Wandel hervor. Denn letztlich geht es um mehr als Technologie. Es geht um unsere Zukunft – und darum, heute die richtigen Entscheidungen zu treffen. (ben)