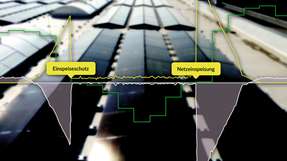Der plötzliche Stopp des Förderprogramms klimafreundliche Nutzfahrzeuge (KsNI) Anfang 2024 war ein Schock. Als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) und der dadurch erforderlichen Haushaltskonsolidierung war für die Fortsetzung kein Geld mehr da. Dennoch gab es gültige Förderzusagen für 6.607 Fahrzeuge und 2.486 Ladesäulen, von denen aktuell mindestens 4.443 Fahrzeuge und 648 Ladesäulen bereits beschafft und in Betrieb sind, wie aus dem Evaluationsbericht der Bundesregierung hervorgeht.
Das Förderprogramm habe gerade in der Fahrzeugklasse N1 (leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen) mit seiner Förderung zu einer Entlastung der Logistikbranche geführt, schreibt die Regierung. In den Klassen N2 (mittelschwere Fahrzeuge von 3,5 bis 12 Tonnen) und N3 (schwere Nutzfahrzeuge über 12 Tonnen) sei es zu keiner Mehrbelastung der Unternehmen durch ihren Umstieg auf alternative Antriebe gekommen. „In Summe gab es durch die KsNI-Förderung insgesamt eine leichte Entlastung der Branche“, lautet das Gesamtfazit.
Negative Marktwirkung durch Stopp
Das Ziel der Richtlinie – eine Marktaktivierung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge sowie die Treibhausgasminderung im Straßengüterverkehr – wurde laut Bundesregierung erreicht. „Insgesamt war die Förderung erheblich in Höhe und Umfang und stellt einen Leuchtturm für die Markteinführung von klimafreundlichen Nutzfahrzeugen in Europa dar“, heißt es in dem Bericht. Deutliche wird aber auch: Die frühzeitige Beendigung des KsNI-Förderprogramms hat sich ungünstig auf den Markt ausgewirkt „und insbesondere bei der Nachfrageseite zu einer abwartenden Haltung sowie teilweise auch wieder zu verstärkter Unsicherheit hinsichtlich zukunftsfähiger Antriebstechnologien bei schweren Nutzfahrzeugen geführt“.
Hat sich der Anteil klimafreundlicher Nutzfahrzeuge während des Förderungszeitraums aber tatsächlich erhöht? Ja, sagt die Bundesregierung. Gerade in der Klasse N3 sei die Förderung entscheidend für den Markthochlauf gewesen. „Über die Hälfte der bundesweit im Betrachtungszeitraum 2021 bis 2024 neu zugelassenen klimafreundlichen Nutzfahrzeuge hat eine KsNI-Förderung in Anspruch genommen.“
Die von der Regierung ausgemachte „deutliche Steigerung“ beim Angebot kommerziell verfügbarer schwerer klimafreundlicher Nutzfahrzeuge im Zeitraum der KsNI-Förderung hat aber andere Ursachen. Die europäischen CO₂-Flottenzielwerte sowie starke finanzielle Anreize in den Betriebskosten wie die Mautreduktion für emissionsfreie Fahrzeuge werden in der Vorlage genannt.
80 Prozent Förderquote: Über- oder Unterförderung?
Die Evaluation des KsNI-Programms widmet sich zentral der Frage, inwiefern die Förderquote von 80 Prozent der Mehrkosten für klimafreundliche Fahrzeuge gegenüber Dieselfahrzeugen angemessen war. Konkret also, ob damit in der Realität eine Über- oder Unterförderung erfolgt ist. Im Falle der batterieelektrischen Nutzfahrzeuge der Klasse N3 erscheine in der Nachbetrachtung die Förderquote von 80 Prozent höher als notwendig gewählt, „wenngleich weniger stark ausgeprägt als bei kleineren Fahrzeugklassen N1 und N2“, schreibt die Regierung. Für schwere Brennstoffzellen-Lkw sei sie hingegen zu niedrig gewesen.
Dazu kommt noch das Problem Wiederverkaufswert: Da es für schwere klimafreundliche Nutzfahrzeuge faktisch keinen Gebrauchtmarkt gibt, wurden bei der Beurteilung der Höhe der Förderquote Restwerte von 25 Prozent der Anschaffungskosten angenommen. Liegt der Restwert der Fahrzeuge niedriger, sind die 80 Prozent Förderung der Mehrausgaben in der Anschaffung oft nicht ausreichend.
Keine Kompensation der Mehrkosten durch Einsparungen bei der Maut
Die Einführung der CO₂-Differenzierung bei der Lkw-Maut Ende 2023 hat den erhofften Erfolg aber wohl nicht erbracht. „Selbst bei einem hohen Fahranteil auf mautpflichtigen Straßen kann die technologiebedingte Einsparung von Mautkosten die Mehrkosten der Beschaffung nach Förderung häufig zumindest nicht vollständig kompensieren“, räumt die Bundesregierung ein. (sl)